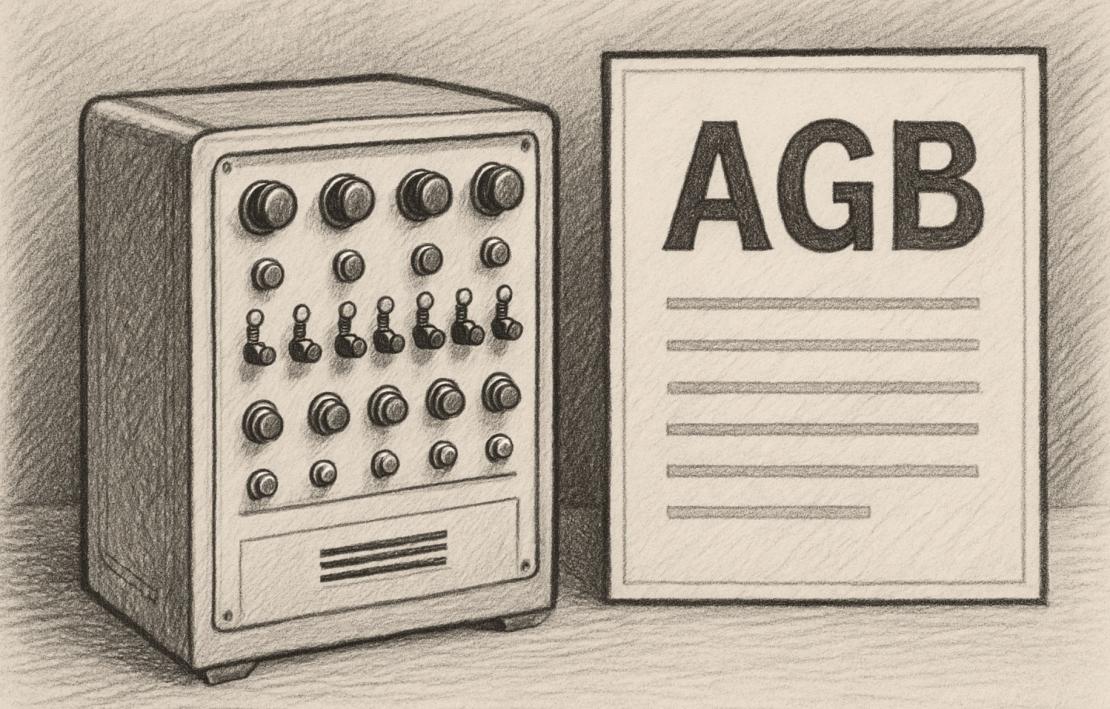AGB in IT-Verträgen: Von Fallstricken und "Best Practices"
Dokumentieren und prüfen Sie Ihre Geschäftsprozesse und IT-Anwendungen mit meiner DSGVO-Giraffe.
Einfach, schnell und kostenlos.
✔ Ermittelt und prüft den relevanten Sachverhalt in einem strukturierten Dialog
✔ Erläutert die konkreten Datenschutzanforderungen
✔ Erstellt Dokumentationen und Rechtstexte – automatisch
DSGVO-Giraffe kostenlos starten
Das Tool ist ein Angebot der matterius GmbH und keine Rechtsberatung.
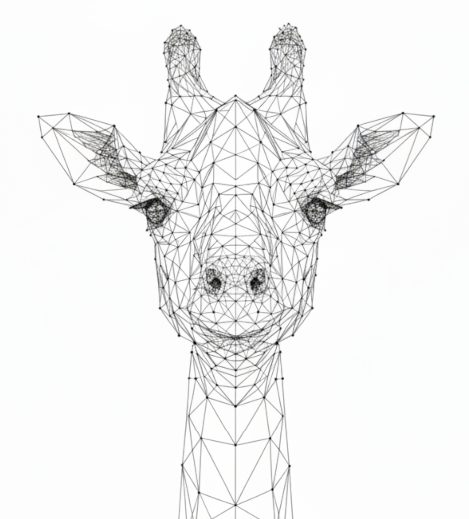
Die IT Branche ist wie viele anderen gepräft von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) . Ob SaaS-Vertrag, Softwarelizenz, IT-Projekt oder Cloud-Service – das „Kleingedruckte“ regelt die entscheidenden Details. Doch AGB sind weit mehr als eine Formalität. Sie sind ein mächtiges, aber auch gefährliches Instrument.
Falsch formulierte oder falsch einbezogene AGB können unwirksam sein und Ihr Unternehmen empfindlichen Risiken aussetzen. Richtig gestaltet, schaffen sie jedoch Rechtssicherheit und optimieren Ihre Geschäftsprozesse.
In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, was AGB sind, wie sie wirksam Vertragsbestandteil werden und wo die typischen Fallstricke lauern – damit Sie rechtlich auf der sicheren Seite sind.
1. Was sind AGB überhaupt? Mehr als nur „das Kleingedruckte“
Die rechtliche Definition für AGB findet sich in § 305 Abs. 1 BGB. Vereinfacht gesagt, liegen AGB vor, wenn drei Kriterien erfüllt sind:
-
Es sind Vertragsbedingungen: Es handelt sich um Klauseln, die den Inhalt eines Vertrages rechtlich gestalten sollen (z. B. Haftung, Kündigungsfristen, Nutzungsrechte). Reine Werbeaussagen oder unverbindliche Hinweise sind keine AGB.
-
Sie sind vorformuliert: Die Klauseln wurden für eine mehrfache Verwendung entworfen. Es spielt keine Rolle, ob sie ausgedruckt, in einer Textdatei gespeichert oder – wie der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt hat – sogar nur „im Kopf“ des Verwenders für zukünftige Verträge abgespeichert sind. Die Absicht zur Mehrfachverwendung genügt.
-
Sie werden von einer Partei „gestellt“: Eine Vertragspartei bringt diese Bedingungen in die Verhandlung ein und beabsichtigt, sie ohne echte Verhandlungsmöglichkeit zum Vertragsinhalt zu machen.
Fallstrick: Ab wann ist „mehrfach“? Viele Unternehmer glauben, sie verwenden keine AGB, weil sie nur wenige Verträge pro Jahr schließen. Vorsicht! Die Rechtsprechung sieht eine „Vielzahl von Verträgen“ bereits bei der beabsichtigten dreimaligen Verwendung als gegeben an. Liegt die Absicht vor, genügt sogar schon die erstmalige Nutzung, um die strengen AGB-Regeln auszulösen.
Abgrenzung zur Individualvereinbarung: Der entscheidende Unterschied zu AGB ist die Individualvereinbarung. Diese liegt nur dann vor, wenn eine Klausel zwischen den Parteien im Einzelnen ausgehandelt wurde. Doch was bedeutet „aushandeln“ wirklich?
Praxis-Tipp: Die hohe Hürde des „Aushandelns“ Ein echtes Aushandeln erfordert mehr als nur das Besprechen oder Erklären einer Klausel. Der Verwender der AGB muss den Kerngehalt seiner Klausel ernsthaft zur Disposition stellen. Der Vertragspartner muss die reale Möglichkeit haben, den Inhalt der Klausel zu beeinflussen.
Fallstricke beim Aushandeln:
-
Wahlmöglichkeiten anbieten: Dem Kunden die Wahl zwischen zwei vorformulierten Klauseln zu geben, ist kein Aushandeln.
-
Unterschrift unter „ausgehandelt“-Klausel: Eine Klausel, die besagt, „alle Vertragsinhalte wurden individuell ausgehandelt“, ist rechtlich wertlos und schützt nicht vor der AGB-Kontrolle.
-
Scheinverhandlungen: Wenn Sie dem Kunden anbieten, über drei Klauseln seiner Wahl zu verhandeln, die restlichen 80 Klauseln aber unberührt bleiben sollen, ist dies extrem wackelig. Es ist fraglich, ob hier der gesamte Vertrag als „ausgehandelt“ gelten kann. Wahrscheinlicher ist, dass die unveränderten Klauseln weiterhin als AGB geprüft werden.
2. Wie werden AGB wirksam in den Vertrag einbezogen?
Damit Ihre AGB überhaupt gelten, müssen sie korrekt in den Vertrag einbezogen werden. Das Gesetz unterscheidet hier streng zwischen dem Geschäftsverkehr (B2B) und dem Verbraucherverkehr (B2C).
a) Im Geschäftsverkehr (B2B): Die erleichterten Regeln
Zwischen Unternehmern ist die Einbeziehung einfacher, aber nicht voraussetzungslos:
-
Hinweis vor oder bei Vertragsschluss: Der Verwender muss klar machen, dass er den Vertrag nur unter Einbeziehung seiner AGB schließen möchte. Dies kann durch einen Satz im Angebot wie „Es gelten unsere beigefügten AGB“ geschehen.
-
Möglichkeit der Kenntnisnahme: Der anderen Partei muss die Möglichkeit verschafft werden, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Es reicht, wenn der Verwender auf die AGB verweist und sie auf Verlangen zusendet. Der Abdruck auf der Rückseite eines Angebots oder das Beifügen als Anhang einer E-Mail genügt in der Regel.
-
Einverständnis: Die andere Partei muss zustimmen. Dies kann auch stillschweigend (konkludent) geschehen, indem sie das Angebot annimmt, ohne den AGB zu widersprechen.
Fallstrick: Der reine Website-Verweis Ein Hinweis im Briefkopf „Unsere AGB finden Sie unter www.unser-it-unternehmen.de“ reicht nicht aus, wenn der Vertrag offline geschlossen wird und kein direkter, klarer Bezug im Angebotsdokument selbst hergestellt wird.
b) Gegenüber Verbrauchern (B2C): Die strengen Hürden
Bei Verträgen mit Verbrauchern sind die Anforderungen nach § 305 Abs. 2 BGB deutlich höher:
-
Ausdrücklicher Hinweis: Der Hinweis auf die AGB muss bei Vertragsschluss ausdrücklich erfolgen. Ein versteckter Verweis genügt nicht.
-
Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme: Der Verbraucher muss die AGB vor Vertragsschluss in zumutbarer Weise lesen können. Das bedeutet in der Regel, dass ihm der vollständige Text zur Verfügung gestellt werden muss (z. B. als PDF-Anhang oder direkter Abdruck).
-
Ausdrückliches Einverständnis: Der Verbraucher muss mit der Geltung der AGB einverstanden sein.
Praxis-Tipp für Online-Shops und SaaS-Portale: Die sicherste Methode zur Einbeziehung ist die sogenannte Checkbox-Lösung:
-
Platzieren Sie direkt vor dem finalen Bestell-Button („Jetzt kaufen“) ein Kontrollkästchen.
-
Der Text daneben sollte lauten: [ ] Ich akzeptiere die [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](Link zu den AGB).
-
Das Kästchen darf nicht vorangekreuzt sein.
-
Der Link muss direkt zu einer les-, speicher- und druckbaren Version der AGB führen.
-
Technisch muss sichergestellt sein, dass die Bestellung ohne das Setzen des Hakens nicht abgeschlossen werden kann.
Es genügt aber auch der bloße Hinweis ohne Checkbox, wie der BGB klargestellt hat.
3. „Battle of the Forms“: Wessen AGB gelten bei widersprüchlichen Klauseln?
Ein Klassiker in der IT-Praxis: Der Anbieter schickt ein Angebot mit Verweis auf seine Verkaufs-AGB. Der Kunde bestellt und verweist auf seine Einkaufs-AGB. Wessen Bedingungen gelten nun?
Früher galt die „Theorie des letzten Wortes“: Wer zuletzt auf seine AGB verwiesen hat, dessen Bedingungen galten. Diese Ansicht ist heute überholt.
Die herrschende Meinung und Rechtsprechung folgt der „Theorie der Kongruenzgeltung“ (Knock-out-Rule):
-
Ein Vertrag kommt trotz der widersprüchlichen AGB zustande, wenn die Parteien mit der Vertragsdurchführung beginnen (z. B. durch Lieferung der Software oder Zahlung).
-
Vertragsbestandteil werden nur die übereinstimmenden (kongruenten) Klauseln beider AGB-Werke.
-
Alle Klauseln, die sich widersprechen, heben sich gegenseitig auf („knock-out“). An ihre Stelle tritt die gesetzliche Regelung (§ 306 Abs. 2 BGB).
Praxis-Tipp: Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihre AGB sich durchsetzen. Wenn bestimmte Punkte für Sie unverzichtbar sind (z. B. eine spezifische Haftungsbegrenzung oder besondere Nutzungsrechte), müssen Sie diese aus dem „Kampf der Formulare“ herausheben und individuell verhandeln und schriftlich festhalten. Nur so können Sie sicherstellen, dass diese Regelung auch wirklich gilt.
4. Die Inhaltskontrolle: Nicht alles, was in AGB steht, ist erlaubt
Selbst wenn AGB wirksam einbezogen wurden, bedeutet das nicht, dass jede Klausel auch gültig ist. Das Gesetz schützt den Vertragspartner vor unfairen Regelungen durch die sogenannte Inhaltskontrolle (§§ 307-309 BGB).
Fallstrick für den B2B-Verkehr: Viele Unternehmer glauben, die strengen Klauselverbote der §§ 308, 309 BGB gelten nur gegenüber Verbrauchern. Das ist ein gefährlicher Trugschluss! Zwar finden diese Paragraphen im B2B-Verkehr keine direkte Anwendung, aber sie haben eine starke Indizwirkung für die Generalklausel des § 307 BGB. Eine Klausel, die einen Unternehmer „unangemessen benachteiligt“, ist auch im B2B-Verkehr unwirksam. Viele Regelungen aus den §§ 308, 309 BGB werden von Gerichten als klares Indiz für eine solche Benachteiligung angesehen (z. B. weitreichende Haftungsausschlüsse für Kernpflichten).
Konsequenz einer unwirksamen Klausel: Ist eine Klausel unwirksam, wird sie ersatzlos gestrichen. An ihre Stelle tritt die entsprechende gesetzliche Regelung. Eine „geltungserhaltende Reduktion“ (also die Rückführung der Klausel auf das gerade noch zulässige Maß) findet nicht statt.
5. Strategien und Vertragsmanagement in der Praxis
Strategie-Tipp: Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren! Wenn Sie tatsächlich über einzelne Klauseln verhandeln, ist eine lückenlose Dokumentation Ihr bester Freund im Streitfall. Bewahren Sie den gesamten E-Mail-Verkehr, Verhandlungsprotokolle und die verschiedenen Vertragsversionen (Redlining) auf. Nur so können Sie später beweisen, dass eine Klausel wirklich „ausgehandelt“ wurde und nicht der strengen AGB-Kontrolle unterliegt.
Fallstrick: Die „Vogel-Strauß-Taktik“ Manche Vertragspartner verzichten bewusst auf Verhandlungen in der Hoffnung, dass die unfairen AGB der Gegenseite im Streitfall ohnehin für unwirksam erklärt werden. Von dieser Strategie ist abzuraten! Ein Vertrag soll Rechtssicherheit für die Zusammenarbeit schaffen und nicht auf einen zukünftigen Prozess spekulieren. Es ist fast immer besser, eine faire und klare Regelung auszuhandeln, als sich auf die Unwirksamkeit von Klauseln und die oft unpassenden gesetzlichen Regelungen zu verlassen.
Das oft vergessene Thema: Vertragsmanagement Insbesondere bei langjährigen Kundenbeziehungen, bei denen Lizenzen nachgekauft oder Services erweitert werden, ist ein sauberes Vertragsmanagement unerlässlich. Große Softwareanbieter ändern ihre AGB regelmäßig.
Praxis-Tipp für Ihr Vertragsmanagement:
-
Versionierung: Speichern Sie zu jedem einzelnen Vertragsschluss (auch bei Nachkäufen!) die exakte Version der AGB, die zu diesem Zeitpunkt galt und einbezogen wurde.
-
Dokumentation: Halten Sie fest, wie die Einbeziehung erfolgte und ob es Abweichungen oder individuelle Verhandlungen gab.
-
Zugriff: Stellen Sie sicher, dass Sie auch Jahre später noch auf diese Dokumente zugreifen können. Der Link auf der Website des Anbieters führt in Zukunft zu einer neuen Version – verlassen Sie sich also nicht darauf.
Ohne diese Dokumentation können Sie im Streitfall oder bei einem Lizenz-Audit kaum nachvollziehen, welche Nutzungsrechte oder Pflichten für welche Software-Version oder welchen Service tatsächlich vereinbart wurden.
Fazit und Ihr nächster Schritt
AGB sind ein zentraler, aber komplexer Baustein des IT-Rechts. Die Tücke liegt im Detail: von der korrekten Einbeziehung über die Grenzen des „Aushandelns“ bis hin zur Inhaltskontrolle und dem Kreuzverweis konkurrierender AGB. Ein unachtsamer Umgang kann dazu führen, dass wichtige Klauseln unwirksam sind und stattdessen die für Sie ungünstigeren gesetzlichen Regelungen greifen.
Fachinformationen
Ratgeber, Muster und Checklisten